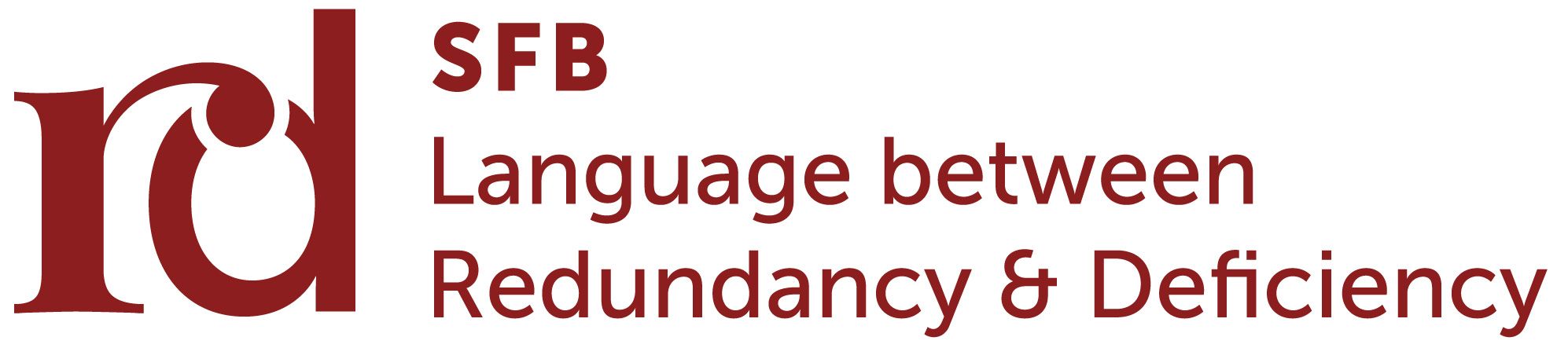Sprache zwischen Redundanz und Defizienz (SFB) stellt sich vor
1 Spezialforschungsbereich : 9 Teilprojekte an 3 Universitäten
SFB - Sprache zwischen Redundanz und Defizienz
Sprache ist eine unserer fundamentalsten kognitiven Fähigkeiten.
Der Spezialforschungsbereich entwickelt einen neuen Ansatz zur Modellierung des sprachlichen Systems. Den Ausgangspunkt bildet die Hypothese, dass der kognitive Kern der Sprachfähigkeit zwar auf logisch-symbolischen Berechnungen basiert, jedoch in ein kognitives System stochastischer Natur eingebettet ist. Als Schnittstelle zwischen der symbolischen und der stochastischen Komponente bedient sich die Grammatik der zentralen Optimierungsfaktoren Redundanz und Defizienz, die sprachlichen Operationen zugrunde liegen können und es ermöglichen, sowohl unter- als auch überspezifizierte Eingaben zu verarbeiten. Der Spezialforschungsbereich bündelt die außerordentlich starke linguistische Forschung an den Universitäten Graz und Wien und befasst sich mit einheitlich definierten, umfassenden empirischen Bereichen der Grammatik (Pronomina und Ellipse). Die Teilprojekte beleuchten, klassifizieren und modellieren diese theoretisch und empirisch unter der Perspektive der Konzepte Redundanz und Defizienz. Die zu erwartenden Erkenntnisse versprechen nicht nur ein tiefergreifendes Verständnis der grundlegenden Mechanismen des grammatischen Systems, sondern eröffnen auch neue Perspektiven für zentrale Fragestellungen der Kognitionswissenschaften hinsichtlich der Rolle der Sprache in der Kognition.
Das Forschungsnetzwerk wurde durch den Wissenschaftsfonds FWF Spezialforschungsbereich finanziert (F1003).
Universität Graz
Trägerforschungsstätte
Mozartgasse 8, 8010 Graz
Koordinator: Univ.-Prof. Dr.phil. Edgar Onea
Projektmitarbeiter: Martina Barili MA, Nastaran Divani MA, Dr.phil. Sarah Melker
Das Koordinationsprojekt fungiert als zentrale administrative und wissenschaftliche Drehscheibe des SFB und wird von einer vom FWF finanzierten Mitarbeiterin (Sarah Melker) unterstützt. Zusätzlich werden zwei Doktorandinnen von der Universität Graz für drei Jahre finanziert (Martina Barili und Nastaran Divani). Die administrativen Aufgaben umfassen die Organisation von SFB-Veranstaltungen, die Abwicklung von Anstellungsverfahren, die Koordination von Gender-Mainstreaming-Maßnahmen, die Sicherstellung des offenen Zugangs zu SFB-Publikationen und -Daten, die Förderung von Chancengleichheit und Inklusion sowie die Stärkung der Öffentlichkeitsarbeit über verschiedene Kanäle. In wissenschaftlicher Hinsicht hat das Projekt die Aufgabe, die Ergebnisse der Teilprojekte und die Theorieentwicklung zu integrieren, Synergien innerhalb der empirischen Studien aufzuspüren und zu nutzen, methodische und statistische Unterstützung zu leisten, den wissenschaftlichen Fortschritt zu überwachen, Publikationen zu verwalten und die theoretischen Grundlagen für die nächste vierjährige Phase des SFB zu schaffen.
Projektleitung: Univ. - Prof. Dr.phil. Edgar Onea
Projektmitarbeiter: Simon Dampfhofer, BA BSc MA
Teilprojekt 2 interessiert sich primär für eine Analyse der diskursstrukturellen Interpretation von Gender-Features. Der Hauptfokus liegt dabei auf der Untersuchung von sogenannten Gender Mismatches – das sind Fälle, in denen das grammatische Geschlecht nicht mit dem semantischen Geschlecht übereinstimmt (z.B. bei „das Mädchen“). Ziel des Projekts ist es, eine detaillierte Theorie für das Syntax-Semantik-Interface von grammatischem Geschlecht aufzustellen, die Phänomene im Kontext von Gender Mismatches erklären kann. Eine zentrale These ist dabei, dass die diskursstrukturelle Rolle Gender analog zu einer Analyse von sogenannten „referential loci“ in Zeichensprachen erklärt werden kann. Methodologisch arbeitet das Teilprojekt an der Durchführung von empirischen Studien, um ein solides Verständnis des zugrundeliegenden Phänomens zu gewinnen. Die Theorieentwicklung soll primär auf Basis von Frameworks der dynamischen Semantik bzw. Diskursrepräsentationstheorie erfolgen.
Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Boban Arsenijevic
Projektmitarbeiter: Dr. Julie Goncharov, Aleksandra Milosavljevic MA, Joeri Vinke MA
Auf der Suche nach einem besseren Verständnis der Bindung von Pronomen beschäftigt sich das Teilprojekt mit der Frage, warum sprachübergreifend intensivierte Pronomen (IntPros) dazu neigen, zu reflexiven Anaphern zu grammatikalisieren. Die Hypothese ist, dass die Bindung auf der Ebene der Informationsstrukturrollen funktioniert: Das Topik bindet den Fokus. Der Intensivierer ist das Element, das diesen Prozess antreibt: ein fokales Reflexiv, das durch das Topik gebunden wird. Während dies in kompositionell zusammengesetzten IntPros offensichtlich der Fall ist, führen redundante und defiziente Schnittstellenoperationen sowohl zur Lizenzierung lokaler als auch satzbezogener Topiken als Binder (siehe P06 für einen ähnlichen Prozess bei der Verdopplung von Klitika) als auch zur fakultativen Interpretation fokaler Merkmale auf dem gebundenen Element, was zu Reflexivierung auf vP- und DP-Ebene führt. Plausiblerweise schließt sich der Zyklus mit der vollständigen Grammatikalisierung von IntPros über Anaphern zu Reflexiva und dem Wiederauftauchen von vollständig interpretierten IntPros. Als Resultat gehorchen IntPros als stärkste Pronomen nicht der allgemeinen Tendenz der Stärke im Rahmen von Bindung, die besagt, dass je stärker ein Pronomen ist, desto größer der strukturelle Bereich ist, in dem es frei sein muss (Cardinaletti und Starke, 1999): obwohl stark, enthalten IntPros ein fokales Reflexiv, das eine lokale Bindung durch das Topik erzwingt. Dies legt die Auswahl der Zielsprachentypen fest auf Malayalam mit IntPros sowohl für die Intensivierung als auch als Anaphern, Englisch mit IntPros hauptsächlich als Anaphern, die zusätzliche fokale Pronomen für die Intensivierung erfordern, Deutsch mit einfachen Anaphern und einem Intensivierer, der ihre Reflexivität verstärkt, und BCMS mit einfachen Reflexiven und voll kompositionellen IntPros. Die wichtigsten Hypothesen beziehen sich direkt auf die Bindung, ein Kennzeichen von R und D, als eine Art und Weise, wie die Grammatik die Pragmatik ausnutzt, um ökonomisch mit ausgedrückter Information umzugehen.
Projektleitung: Assoz. Prof. Dr. Steffen Heidinger
Projektmitarbeiter: Dr. Yanis da Cunha
Animacy features and the flexibility of pronouns untersucht das Mapping zwischen morphosyntaktischen und semantischen Merkmalen französischer und spanischer Personalpronomen aus der Perspektive von R und D. Diese Pronomen sind aufgrund ihres minimalen deskriptiven Gehalts höchst flexible Ausdrücke, und zusätzliche Flexibilität ergibt sich, da ihre Belebtheitsmerkmale nicht unveränderlich sind (z. B. werden französische starke Pronomen meist für menschliche Referenten verwendet, können aber unter bestimmten Bedingungen auch auf Unbelebtes verweisen (Heidinger, 2019)). Das Teilprojekt geht davon aus, dass starke und schwache Pronomen unterschiedlich für Belebtheit spezifiziert sind (Cardinaletti und Starke, 1999, Dobrovie-Sorin, 1999), und untersucht, wie die Belebtheitsmerkmale der Pronomen dann durch R und D manipuliert werden, um ihre Flexibilität zu erhöhen und nicht-kanonische Zuordnungen zu ermöglichen (z. B. starke Pronomen, die auf Unbelebtes verweisen). Das Teilprojekt untersucht somit, wie R und D die Kerngrammatik in die Lage versetzen, durch zusätzliche Flexibilität mit allgemeinem kognitiven Druck umzugehen; z.B. durch Anpassungen in der Pronomenwahl, die durch die Anforderungen bei der Auflösung von Anaphern ausgelöst werden. Die Animacy-Merkmale französischer und spanischer Personalpronomen (vor allem in PPs) bieten einen Einblick in die Vielfalt und die Beschränkungen einer solchen zusätzlichen Flexibilität. Die vergleichende Perspektive auf das Französische und das Spanische ermöglicht es dem Teilprojekt, ein weiteres theoretisches Ziel zu verfolgen, das in direktem Zusammenhang mit den Zielen des SFB steht: Die Pronomeninventare des Französischen und des Spanischen beinhalten beide die Opposition zwischen starken und schwachen Pronomen. Die Sprachen unterscheiden sich jedoch in Bezug auf die Verfügbarkeit schwacher Formen in PPs. Dies bietet ein ideales Testfeld, um zu prüfen, wie R und D in minimal unterschiedlichen Pronomen-Systemen funktionieren.
Paris-Lodron-Universität Salzburg
Projektleitung: Univ.-Prof. Mag., PhD. Susanne Wurmbrand
Mismatches in binding and coreference konzentriert sich auf zwei empirische Bereiche - Fake Indexicals (und andere gebundene Pronomen) und ungebundene Pronomen, die Kovarianz zeigen. P03 untersucht die morphologischen, syntaktischen und semantischen Eigenschaften dieser Arten von Pronomen und vereint sie in einem Modell, in dem die Syntax zwischen LF und PF vermittelt und Merkmale exhaustiv oder redundant auf die Schnittstellen überträgt. Es wird gezeigt, dass Fake Indexicals eine R-Operation von der Syntax zur LF beinhalten, während ungebundene Pronomen eine R-Operation von der Syntax zur PF verwenden. Die beiden ansonsten recht unterschiedlichen Phänomene sind somit Spiegelbilder des jeweils anderen im Rahmen von R/D des SFB. Ausgangspunkt des Teilprojekts ist eine detaillierte syntaktische Untersuchung der Struktur von Pronomen (z. B. Größe und Art der syntaktischen Projektionen), der in Syntax, Morphologie und Semantik beteiligten Merkmale, etwaige Mismatches zwischen den Komponenten, und der Ursprungs von Merkmalen (Bindung, nicht ausgedrückte Strukturen). Die Ausgangshypothesen lauten, dass i) Fake Indexicals syntaktische Bindung durch das echte Indexical involvieren, die durch eine (syntaktische) Fokusbindung ermöglicht wird, und ii) dass ungebundene Pronomen in der Syntax definite Nominalphrasen sind, die einen Ellipsenprozess durchlaufen. Das Teilprojekt ist für alle vom SFB aufgeworfenen Fragen unmittelbar relevant und zielt darauf ab, ein Modell beizusteuern, das die Formalisierung der R/D-Mechanismen ermöglicht. Neben dem theoretischen Fokus von P03 beinhaltet es auch eine empirische Komponente, eine detaillierte Untersuchung von Fake Indexicals im Romanischen und Slawischen. P03 ist - empirisch und/oder theoretisch - mit den meisten anderen Teilprojekten verbunden, und es wurden bereits mehrere Kooperationen ins Auge gefasst.
Universität Wien
Projektleitung: Assoz. Prof. Dr. Dalina Kallulli
The (Non-)Deficiency and (Non-)Redundancy of Clitic Pronouns
Mit dem Schwerpunkt auf Clitic Doubling(CD) stellt das Teilprojekt die grundlegende Frage nach der Ontologie des Bereichs zwischen Agreement, Klitika und schwachen und starken Pronomen sowie nach der zugrundeliegenden Natur der darin enthaltenen Kategorien. Die starke Hypothese ist, dass diese alle dieselbe grammatische Klasse von Elementen instanziieren, die sich jedoch in der Größe der zugrundeliegenden Struktur voneinander unterscheiden, ebenso wie in den Merkmalen, die die Realisierung verschiedener Stärkegrade auslösen. Unter der Hypothese, dass die Antwort auf die letztgenannte Frage in Kiparskys D-Hierarchie von 2008 zu suchen ist (Kallulli, 2016, 2018, 2019), und unter der Annahme einer universellen Realisierung aller in der Reihe enthaltenen Items, setzt das Teilprojekt an, die Stärke der Realisierung in Bezug auf verschiedene Arten von D und R zu modellieren, einschließlich Operationen wie Impoverishment oder Regeln der Exponenz. Insbesondere wird die Hypothese aufgestellt, dass das verantwortliche Merkmal für alle wiederholten Realisierungen [Topik] ist, dass es aber im Prozess der Grammatikalisierung geschwächt wird. Letztlich wird die Verdopplung verallgemeinert und durch bloße syntaktische Lokalität angetrieben. Was als Topik-Verdopplung in einer bestimmten Position beginnt, endet als Agreement mit dem höchsten Argument oder als universelles Clitic Doubling. Abhängig von verschiedenen Faktoren, zu denen vor allem der Grad der Grammatikalisierung und die syntaktische Position gehören, zeigen Sprachen Verdoppelungseffekte unterschiedlicher Stärke, von verschiedenen Nullelementen über Agreementbis hin zu Klitika. Die wichtigsten empirischen Fragen, mit denen sich das Unterprojekt befasst, betreffen Bindung, Rekonstruktionseffekte, Resumption, den Person-Case-Constraint und (Anti-)Lokalitätseffekte, die mit klitischen Pronomen verbunden sind. Der Vergleich von Sprachen mit und ohne Klitika oder CD hinsichtlich der zugrundeliegenden semantischen Merkmale informiert Q1 und Q3, die Art und Weise, in der CD Bindungsbeziehungen beeinflusst, ist für Q2 relevant und die Analyse von LF- und PF-Effekten in Verbindung mit CD informiert Q4.
Projektleitung: Ass.Prof. Mag. Dr. Albert Wall
Projektmitarbeiter: Philippa Adolf MA, Marco Losavio MA
Defizienz und Redundanz in iberoromanischen Pronominalsystemen untersucht die Variation der Verdopplung von Akkusativklitika und der Null-Direct-Objects in und zwischen spanischen und portugiesischen Varietäten. Während sich die Menge der pronominalen Elemente und die verfügbaren Oberflächenkonfigurationen in diesen Varietäten zu einem beträchtlichen Teil überschneiden, sind die Unterschiede zwischen ihnen auffällig und stellen einheitliche Theorien vor Herausforderungen(Maddox, 2021). Darüber hinaus erfordern viele der Generalisierungen, die einheitlichen Theorien zugrunde liegen, eine solide empirische Überprüfung. Aufbauend auf der Arbeit von Di Tullio et al. (2019) zur Verdopplung von Akkusativ-Klitika im Rioplatense-Spanisch befasst sich das Teilprojekt mit weiteren Forschungslücken in Bezug auf Null-Objekte in spanischen Varietäten und Clitic Doubling im Portugiesischen, wie z. B. dem kürzlich „entdeckten“ System der Verdopplung von Akkusativ-Klitika in der Mineiro-Varietät des brasilianischen Portugiesisch (Machado Rocha und Ramos, 2016). Das Teilprojekt wird parallele experimentelle Studien verwenden, um einen hochgradig vergleichbaren Datensatz für mindestens vier Varietäten (Rioplatense und Halbinselspanisch, brasilianisches Mineiro-Portugiesisch und europäisches Portugiesisch) zu erhalten und die „Minimalpaare“ von Kontrasten zu erforschen, die in ihnen gefunden wurden, um zu sehen, wie sich R und D in den jeweiligen Systemen verhalten. Während die Existenz von nahezu gegensätzlichem Verhalten in so eng verwandten Sprachen sowohl für konventionelle formale als auch für funktionale Erklärungen im Wesentlichen ein Rätsel bleibt, wird das Teilprojekt die Idee verfolgen, dass die Haupthypothese des SFB (zumindest eine teilweise) Antwort darauf liefert. Wenn R und D ein Mittel des symbolischen grammatischen Systems sind, um sich an die stochastische kognitive Umgebung anzupassen, dann ist ihre allgemeine Verfügbarkeit ein direkter Ausgangspunkt für eine Erklärung, die im Rahmen des Teilprojekts verfolgt werden soll und somit direkt zu Q1 beiträgt. Darüber hinaus liefern die im Rahmen des Teilprojekts durchgeführten empirischen Studien wichtige Daten, die sich direkt auf Q3 und Q4 beziehen.
Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Eva-Maria Remberger
Projektmitarbeiter: Dr. Peter Herbeck, Andrea Miglietta MA
Fading reference - the pragmaticalization of pronoun + verb untersucht Pronomen-Verb-Kombinationen (prVC) vor allem im gesprochenen Spanisch und Italienisch und konzentriert sich dabei auf ihr prototypisches Auftreten als inhaltsreiche Prädikate, ihre potentiell grammatikalisierte Form als Diskursmarker, vor allem aber auf den unterschiedlichen Grad der Fixierung in intermediären, z.B. parentheti- schen Formen. Es werden die Diskursfunktionen von prVCs, die aus Verben der Kognition, Kommunikation und Wahrnehmung gebildet werden, und ihre Abhängigkeit von den Pronomentypen und ihrer Merkmalsausprägung, dem Verbtyp und der -form, dem Vorhandensein anderer funktionaler Elemente sowie den beteiligten syntaktischen Positionen dargestellt. Grundlegende grammatische Operationen in Morphosyntax und Morphophonologie sowie an der semantisch-pragmatischen Schnittstelle scheinen entweder die im pronominalen Item vorhandenen Merkmale nicht zu berücksichtigen (R) oder sie an der Schnittstelle von LF und Diskurskontext als andere oder zusätzliche pragmatische Merkmale umzudeuten, die ursprünglich nicht als solche spezifiziert sind (D). Das Teilprojekt untersucht daher den Einfluss der Merkmalsspezifikation von Pronomen in Bezug auf R (Ausblenden von referentiellen Merkmalen) und D (Anreicherung mit pragmatischen, auf den Sprachkontext bezogenen Merkmalen) auf die Entwicklung von prVCs. Das Teilprojekt trägt zu den übergeordneten Zielen des SFB bei, indem es einen mikroskopischen Blick darauf wirft, wie die Flexibilität von R und D an den Schnittstellen zu PF und LF theoretisch modelliert werden kann, um das Veränderungspotenzial und die Auswirkungen kontextueller linguistischer und außersprachlicher Faktoren (einschließlich der Häufigkeit im Sprachgebrauch) auf das grammatische System zu erklären. Dabei adressiert das Teilprojekt drei Hauptfragen des SFB: Q1 durch die Fokussierung auf Grammatikalisierungs-/Pragmatikalisierungsprozesse als eine Strategie zur Überbrückung von Diskrepanzen zwischen Formen und kommunikativen Zielen, Q2 durch die Untersuchung der syntaktischen Konsequenzen dieser Diskrepanzen an der linken Peripherie und Q3 durch die Untersuchung der Merkmalsspezifikationen von Pronomen in prVCs.
Projektleitung: Univ.-Prof. Dr. Daniel Büring
Projektmitarbeiter: Melanie Loitzl, Justina Schindler
Deficiency and Redundancy in Expressing Temporal Relations entwickelt eine formale semantische Theorie von Tempusals Pronomen und bettet sie in ein größeres semantisches Modell temporaler Ausdrücke ein, einschließlich Temporaladverbialen, quantifizierenden Adverbialen und Aspekt. Von besonderem Interesse ist die temporale (Unter-)Spezifizierung von Tempusmerkmalen auf Tempusmorphemen und ihr Verhalten, wenn sie durch andere Tempusformen, intensionale Verben oder temporale Adverbien gebunden sind. Die Fokussierung auf diese Aspekte erlaubt es uns, die insbesondere in Teilprojekt 02 und Teilprojekt 03 entwickelten Ideen über freie und gebundene Personalpronomina in einer anderen ontologischen Domäne direkt anzuwenden, wodurch wir die Hypothese überprüfen können, dass es nicht-oberflächliche Gemeinsamkeiten zwischen pronominalen Systemen über Domänen hinweg gibt. Die Untersuchung im Teilprojekt basiert vergleichend auf Sprachen mit artikulierten Tempussystemen wie Englisch und Deutsch, Sprachen mit artikulierten Aspektsystemen wie Russisch und anderen slawischen Sprachen und so genannten tense-less Sprachen wie Mandarin-Chinesisch. Das Teilprojekt erweitert nicht nur den empirischen Anwendungsbereich des SFB auf eine neue ontologische Domäne, es befasst sich auch zentral mit Q1, indem es Equilibrien zwischen dem Bereich der Bedeutungen und einer begrenzten Domäne verfügbarer Formen untersucht, es informiert Q2 hinsichtlich der Bindung im temporalen Bereich und untersucht die Rolle der syntaktischen Struktur (Q4) und der Merkmalsspezifikation (Q3) in der formalen Semantik.